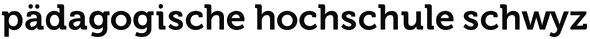Die Corona-Zeit ist wohl die herausfordenste Zeit seit Jahrzehnten. Seit dem 2. Weltkrieg waren die staatlichen Eingriffe in das öffentliche und private Leben nie so stark. Und der persönliche Umgang damit wie auch die öffentliche Wahrnehmungen sind nicht immer gleich. Gefordert ist: Solidarität zwischen den Generationen, damit der Virus weniger Chancen bekommt, sich zu rasch auszubreiten.
Trotz diesen kurzfristigen Sofortmassnahmen braucht es aber in und nach dieser Zeit die Reflexion über die Fragen nach der Gestaltung der Gesellschaft. Nicht nur über jene, in der wir konkret leben, sondern auch die globale. Die Diskussion wird dabei in der Trias von den Gesundheitsansprüchen des Individuums, der Wirtschaft und der Demokratie laufen.
Ansprüche an die eigene Gesundheit sind immer geprägt von einem bestimmten Weltbild. Das Gesundheit zum höchsten Gut für die meisten von uns geworden ist hängt wohl u.a. damit zusammen, dass tatsächlich die Medizin in den letzten Jahrzehnten grosse Erfolge zu verzeichnen hatte. Aber die Ansprüche hängen auch davon ab, dass wir als Menschen letztlich einem ganz tief verankerten «Heilsanspruch» nachkommen und uns in einen Modus der Verfügbarkeit über Leben überhaupt ergeben. Ja – und in einem solchen Modus wird dann der Tod zum «Skandal» und wir haben verlernt, den Tod in das Leben zu integrieren. Der Virus hat uns hart getroffen in unserem Weltbild der Machbarkeit und Verfügbarkeit.
Unser wirtschaftliches System dagegen lebt vom kapitalistischen Grundaxiom des Wachstums, der Effizienzsteigerung und der Konkurrenz. Wachstum zu jedem Preis und Effizienzsteigerung zu jeder Zeit – und nun ein unsichtbarer Virus, der zum zeitweiligen Stillstand und gesellschaftlichen Lockdown führt. Das ganze System ist betroffen und manch einer fragt sich, wie es weitergehen soll. Eines ist dabei klar: Die weltweit organisierten Produktionsketten werden wohl in dieser Art, wie jetzt, kaum mehr ausgebaut werden, eher stellt sich die Frage, wie diese in einer globalisierten Welt lokal, regional, kontinental organisiert werden. Das Wirtschaftssystem baut sich um, bisherige Prämissen haben – so ist zu hoffen – nicht mehr dieselben Prioritäten. Und damit ist klar: Wirtschaftssysteme sind geschaffene Systeme, nicht naturgesetzlich gegeben sondern mit intellektueller und politischer Kreativität umzugestalten. Nachhaltigkeit und der Schutz der natürlichen und geistigen Ressourcen sind damit verbunden.
All diese anstehenden gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungsprozesse sind dabei nun in politischen Systemen möglich, in denen Diskurs, Argumentation, Kommunikation, Wissenschaft, Menschenwürde und Toleranz Fundamente sind. So sind es gerade nicht die autoritären Systeme, die Erfolg im geforderten Umgestalten der Gesellschaft Erfolg haben werden, sondern es sind die demokratischen. Und dass die starken Demokratien gestärkt aus der Krise gehen ist so sicher, wie schwache dagegen der Gefahr der eigenen autoritativen Stärkungen erliegen. Diese werden aber keine Zukunft haben. Autoritative Staatssysteme selbst werden in sich zusammenfallen, weil schlicht ein Grundprinzip nicht existiert: Das Prinzip, falsch zu handeln oder Unsicherheit zu manifestieren. Aber: Neues fordert neue Handlungsweisen, die in der Unsicherheit ihres Gelingens stehen und – im Nachhinein gewertet – auch falsch sein konnten. Nur in diskursorientierten kommunikativ aufgebauten gesellschaftlichen Strukturen kann es aber gelingen, diese Unsicherheiten und die Möglichkeit der falschen Entscheidung auszuhalten und zu gestalten. Damit verbunden aber sind lange zeitliche Prozesse, die aber in ihrer Wirkung tragfähige und veränderbare Lösungen ermöglichen. Deshalb darf nur um der Kurzfristigkeit das Wort zu reden, Demokratie nie – auch in dieser Krise nicht – aufs Spiel gesetzt werden.
Es ist der intellektuelle Zweifel mit seinem erkenntnistheoretischen Konjunktiv ist es, welcher der Motor für die Zukunft darstellt. Dieses erkenntnistheoretische Axiom ist, spätestens mit Michel de Montaigne oder ganz sicher mit René Descartes für unsere Kultur, in der Wissenschaft und in der Kommunikation das entscheidende Prinzip: Ohne Zweifel, kein Fortschritt. Ohne das Bewusstsein des Zweifel, also dem Bewusstsein, dass etwas auch anders sein könnte, wird gesellschaftliche die Bühne für Fundamentalismen oder Gleichgültigkeit geöffnet. Toleranz in ihrem ureigensten Sinn wird zerstört. Die Toleranz nämlich, die sich bewusst ist, das etwas auch anders sein könnte. Dieser intellektuelle Zweifel, dieser erkenntnistheoretische Konjunktiv, ist es, der nur in demokratischen Systemen mit ihren Instanzen gesellschaftlich zur Voraussetzung wird, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu ermöglichen. Dieser Zweifel ist es, der Wissenschaft in ihrem Grundverständnis ausmacht und ganz im Sinne der kritischen Rationalismus zur eigentlichen dynamischen Kraft für Weiterentwicklung wird. Heute mit der Hermeneutik der Nachhaltigkeit und der Erfahrung der Begrenztheit.
Und damit können wir in demokratischen Systemen politische Prozesse gestalten, welche das ökonomische, soziale, weltanschauliche Zusammenleben gestaltet und eine Zukunft schafft, in der auch unsere Kinder eine lebenswerte Erde übernehmen dürfen: In einer Zeit nach – oder vielleicht noch für eine Phase mit – dem Virus.